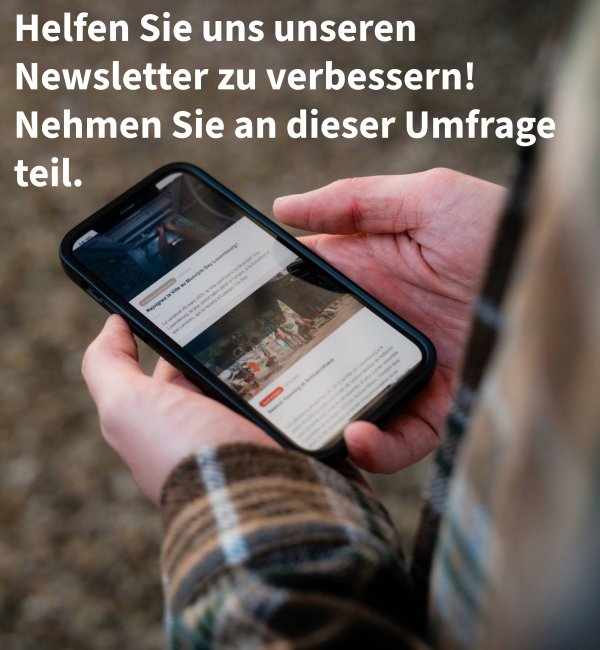Kurzgefasst
Die Bezeichnungen „Klimabaum“ oder auch „Zukunftsbaum“ haben heute sehr an Bedeutung gewonnen. Diese Bezeichnung bezieht sich jedoch nicht auf die Fähigkeit den Klimawandel aufzuhalten, sondern auf die Eigenschaften des Baumes, sich an den Klimawandel anzupassen ; die die zunehmenden, als Klimawandel bezeichneten Wetterphänome, oder auch extreme Wetterverhältnisse besser bzw. unbeschadeter überstehen können als unsere heimischen Sorten. Diese leiden sehr unter der starken Hitze und der Trockenheit (insbesondere die Rotbuche, Fagus sylvatica) und die Fichte (Picea abies), um nur die bekannteren Arten zu erwähnen.
Baumsorten
Es werden seit fast zwei Jahrzehnten in vielen europäischen Ländern - beispielsweise in Frankreich, der Schweiz, Deutschland und Dänemark - groß angelegte Versuche durchgeführt, um die Baumarten zu ermitteln, die für viele Verwendungen geeignet sind, insbesondere als Straßenbaum.
Zwischen einem Versuch und einer definitiven Empfehlung als sogenannter „Zukunftsbaum“ können zwei bis mitunter drei Jahrzehnte vergehen.
Bei Klimabäumen handelt es sich um einheimische Arten, z. B. unsere Winterlinde (Tilia cordata) und Linden-Bastarde (Tilia x europaea), Stiel- und Traubeneichen (Quercus robur, Quercus petraea), der Feldahorn (Acer campestre) und alle daraus abgeleiteten gartenbaulichen Arten und Kultivare.
Zu den nicht einheimischen Arten zählen vor allem Zerreichen (Quercus cerris), der südliche Zürgelbaum (Celtis australis), die amerikanische Gleditsie (Gleditsia triacanthos) und viele andere.
Es ist aber nicht so, dass Klimabäume die einzigen Bäume sind, die man noch sicher in der Stadt verwenden kann. In der Stadt Luxemburg gibt es Flächen mit z.B. Rotbuchen (Fagus sylvatica), die nicht den ganzen Tag in der Sonne stehen und gut wachsen.
Einige Beispiele für Klimabäume








Trockenstress
Bereits die Sommer 2003 und 2013 gingen in die Geschichte der Extremtemperaturen ein, aber spätestens seit den Sommern 2018-2022 ist die Klimawandeldiskussion aktueller als je zuvor. Die Trockenschäden an Bäumen des Sommers 2022 zeigen bei schwächeren Bäumen schon jetzt viele Ausfälle, die in den kommenden Jahren ihre Auswirkungen zeigen werden.
Trockenstress bezeichnet bei Bäumen die Belastung durch Wassermangel. Trockenstress hat unterschiedliche Merkmale, da Bäume als Lebewesen dem Wassermangel mit verschiedenen Strategien begegnen. Es ist abhängig von der Baumart, wie diese mit dem Trockenstress umgeht – z. B. genetische Grundausstattung – Anpassung, Toleranz, Ertragen bis Vermeidung.
Wichtige Trockenstressfaktoren
Der Zeitraum, in dem die Trockenperiode im Frühjahr und im Sommer auftritt, ist problematisch. Eine Trockenperiode von über 4 Wochen ohne Wasserversorgung schädigt viele Baumarten.
Die Kombination mit anderen Stressfaktoren wie der Hitze-Frost-Beschaffenheit des Bodens, die vor allem die Wasserhaltefähigkeit und die Sauerstoffversorgung in den Wurzelschichten beeinträchtigt, aber auch die intensive Sonneneinstrahlung, die zunehmend Schädigungen an Bäumen und Blättern verursacht, setzt den Bäumen zu.
Hinzu kommen andere Faktoren wie die Tiefe des Wassermangels im Boden, die Erreichbarkeit des Grundwasserspiegels, die Lufttrockenheit im Stadtgebiet, das Baumalter, Vorerkrankungen und Pilzbefall, aber auch der Standort, beispielsweise Baumscheiben im Stadtgebiet, bei denen man sich die Frage nach dem verfügbaren Volumen für die Wurzeln und der Wasserversorgung stellen muss.
Ein weiterer sehr wichtiger Faktor, der oft vergessen oder vernachlässigt wird, ist der Einfluss von Streusalz auf Straßenbäume. Natrium-Chlorid (NaCl) zerstört die Bodenstruktur, das sogenannte kolloidale Gefüge. Streusalz im Winter ist zwar nicht direkt ein Auslöser für Trockenstress, ist aber im Prozess und in der Konzentration ein wichtiger Punkt. Es ist ein Antagonist von Calcium und vor allem Kalium, das heißt, es verhindert dessen Aufnahme ins Pflanzengewebe. Kalium und Magnesium sind für den Wasserhaushalt in Pflanzen von wesentlicher Bedeutung. Dies äußert sich bei empfindlichen Bäumen mit deutlichen Blattrandnekrosen (bräunliche Ränder).




Baumsorten für die Zukunft
Es existieren mittlerweile viele Studien, Listen und auch Anpflanzungen in Städten, um die geeignetsten Baumarten in Städten zu bestimmen.
Es gibt eine KlimaArtenMatrix, in Deutschland KLAM, die aber auch in den Niederlanden Verwendung findet (z. B. Baumschulen), in der mittels eines Punktesystems die Bäume nach Ihrer Eignung zur Trockentoleranz und Winterhärte geprüft werden.
Winterhärte ist insofern entscheidend, da immer mehr Baumarten aus südlicheren Gefilden zu uns in Kultur kommen, die zwar eine gute Trockentoleranz aufweisen, aber für unsere Winter nicht unbedingt geeignet sind.
Zu berücksichtigen ist auch, dass die Lage (Straße – Grünanlage) mit ihrem Mikroklima kleine und mittlere Unterschiede für die erfolgreiche Anpflanzung hervorbringt.
Wichtig ist zu verstehen, dass nicht jeder „Klimabaum“ auch an jedem Standort gut wächst!
Beispiel
Die morgenländische Platane (Platanus orientalis) stammt aus Südeuropa bis in den westlichen Himalaya. Sie hat eine große Trockentoleranz aber die Winterhärte ist problematisch. Das heißt, sie kann in extremkalten Wintern schon zurückfrieren. Entscheidend sind nicht immer die tiefen Temperaturen an sich, sondern deren Zeitdauer. Bei der Trockenheit ist das ähnlich.
Auswahl neuer Baumsorten
Es ist wichtig in Zukunft auf eine gesunde Mischbepflanzung zu achten, die sowohl Klimabäume als auch einheimische Arten berücksichtigt.
In der Rue Anatole France ist zum ersten Mal eine sogenannte Mischbepflanzung vorgenommen worden. Bisher wurden ganze Straßenzüge mit nur einer Baumart bepflanzt, um einerseits die Ästhetik durch eine uniforme Kronenentwicklung und eine gleichmäßige Entwicklung zu gewährleisten und andererseits den Baumschnitt zu vereinfachen. Einer der Nachteile war jedoch, dass wenn ein Baum von einer Krankheit befallen wurde, diese sich auf alle Bäume der gleichen Art ausbreitet.
Deshalb wird in Zukunft versucht, Straßen, deren Lichtraumprofil es erlaubt, mit mehreren Baumgattungen und Arten zu bepflanzen, wie es in der rue Anatole France neuerdings der Fall ist.
Klimabäume der Stadt
Quercus (Eiche)
Quercus ist der lateinische Name für Eiche. Die Eichen sind eine wahrhaft große botanische Familie, die zu den Buchengewächsen (Fagaceae) gehört. Sie können in guter Lage über tausend Jahre alt werden. Eichenarten sind weltweit verbreitet – von Nord amerika über Mexiko, die Karibischen Inseln, Kolumbien in Zentral amerika, Eurasien und Nordafrika.
Eichenholz ist sehr beliebt und von hoher Qualität und Langlebigkeit.
Auch die Eiche wird zu den trockenheitsresistenten Arten gezählt, darunter die Stieleichen (Quercus robur), Traubeneichen (Quercus petraea) sowie die Zerreichen (Quercius cerris) und die Ungarische Eiche (Quercus frainetto).
Kataster: Der Gesamtbestand der Eichen in der Stadt (alle Arten und Sorten) beträgt 1 765 Bäume.
Tilia (Linde)
Der Name „Tilia“ stammt aus dem Griechischen „tilos“ und bedeutet Faser. Die Rindenfasern wurden früher bei der Produktion von Schuhwerk und Tauen eingesetzt.
Die Winterlinde (Tilia cordata), auch Steinlinde oder Herzblattlinde aus der Familie der Malvengewächse (Malvaceae, Unterfamilie Tilioidaea), ist in Europa heimisch und kann gut über 500 Jahre alt werden. Die Blüten liefern viel Nektar für den berühmten Lindenblütenhonig.
Die Hauptnutzung des Lindenholzes liegt in der Bildhauerei, Schnitzerei und Drechslerei.
Die Linde ist in verschiedenen Testreihen eine Baumart, die gut an trockenen Boden angepasst ist und auch längere Hitzeperioden übersteht.
Kataster: Der Gesamtbestand der Linden in der Stadt (alle Arten und Sorten) beträgt 2 213 Bäume.
Acer (Ahorn)
Die Gattung der Ahorne (Acer) aus der Familie der Seifenbaumgewächse (Sapindaceae) ist in Eurasien, Nordafrika, Zentral- und Nordamerika weit verbreitet.
Kataster: Der Baumbestand an Ahorn in der Stadt beträgt 3 372 Bäume.
Einige Bäume werden vom luxemburgischen Staat gepflegt.